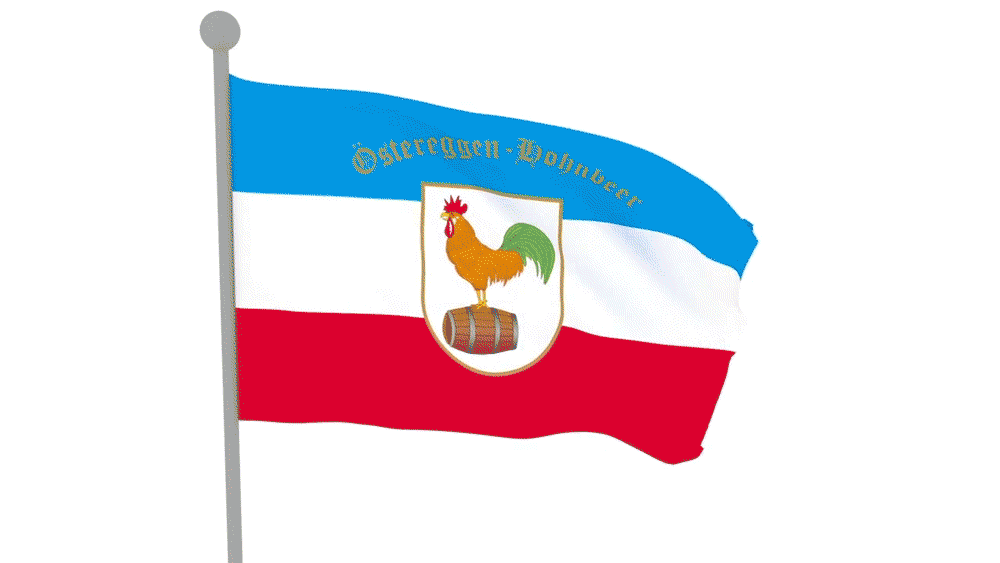


Geschichte des Heider Hohnbeer
Erste Erwähnung der Eggen
Der Flecken Heide
Es war um das Jahr 1400. Die vier Bauernschaften Wesseln, Lohe, Rickelshof und Rüsdorf grenzten auf dem Gebiet des heutigen Heide aneinander. Sie gehörten zu den Kirchspielsgemeinden Weddingstedt (Wesseln und Rüsdorf) und Hemmingstedt (Lohe und Rickelshof). Und eben jene wollten ein Gegenpart zu dem bisherigen Hauptort Dithmarschens Meldorf spielen und so gründeten sie den Flecken „up de Heyde“. Jede Bauernschaft gab einen Teil seines Territoriums ab. Das geschah natürlich nicht, ohne sich vorher die entsprechenden Siedlungsrechte zu sichern. Da der Ort sich schnell zu einem wichtigen Handels- und Versammlungsplatz entwickelte, war diese Entscheidung sicherlich sehr lohnend. Die vier Teile, aus denen der Flecken Heide so entstand, verwalteten sich selbständig und wurden Eggen genannt, ergänzt um die jeweilige Himmelsrichtung ihrer Lage. Die Norderegge entstand aus einem Teil des Gebiets der Bauerschaft Wesseln, die Westeregge aus dem Teil, den Rickelshof gegeben hatte, die Süderegge gehörte bis dahin zu Lohe und dem verhältnismäßig größten Anteil gab das kleine Rüsdorf zur Österegge. Der Flecken Heide sollte zunächst zur Kirchspielsgemeinde Weddingstedt gehören, bis im 16. Jahrhundert ein eigenes Kirchspiel gegründet werden durfte. Weddingstedt hatte von den Bauernschaften Wesseln und Rüsdorf einen deutlich größeren Teil mit der Norder- und Österegge gegeben als Hemmingstedt mit der Wester- und Süderegge. Gerade die Westeregge war deutlich kleiner als die anderen drei Eggen.
Nachdem die Dithmarscher 1559 nach der letzten Fehde ihre Eigenständigkeit verloren hatten, hatte diese Niederlage auch direkte Folgen für die Entwicklung des noch jungen Fleckens. Nach einer kurzen Dreiteilung folgte 1581 schließlich die bis 1970 währende Zweiteilung des heutigen Kreises Dithmarschens. Hemmingstedt und damit die Bauernschaften Lohe und Rickelshof wurde dem königlichen Süderdithmarschen, Weddingstedt mit den Bauernschaften Wesseln und Rüsdorf sowie der Flecken Heide selber wurde dem herzoglichen Norderdithmarschen zugeordnet. Das hatte für die Westeregge fatale Folgen. Der kleinen Egge fehlte fortan der wirtschaftliche Rückhalt des Ursprungdorfes und so wurde sie schließlich kurze Zeit später aufgelöst. Sie ging in der Norder- und Süderegge auf.
Das Hahnenfest
Auch wenn Heide als Handels- und Versammlungsort an Wichtigkeit gewann, waren die Bewohner zum größten Teil aufgrund ihrer Historie Bauern. Neben ihrer Arbeit für die eigenen Höfe verrichteten sie genauso Gemeinschaftswerk, sogenanntes Meentwark. Die Erträge dieses Meentwarks wurden in der kalten Jahreszeit, wenn wenig Arbeit auf dem Feld war, abgerechnet. Ergänzend zu dem Brauch des Faslom, der ländlichen Tradition in Norddeutschland, den Winter zu vertreiben, entwickelte sich in Heide ein Fest, um der Abrechnung des Meentwarks eine gesellige Komponente zu verleihen. Mittelpunkt dieses Festes war das Einsperren eines Hahns in ein Holzfass. Dieses wurde so lange mit Boßelkugeln beworfen, bis es zerbrach. Wenn der Hahn diese Tortur überlebte und die Freiheit zurück erlangte, galt das als gutes Omen für das kommende Wirtschaftsjahr. Auch zog man bei diesem Fest durch den Ort und besuchte die Gemeindemitglieder.
Jede Egge feierte dieses Buernreeken selbständig, da das Meentwark getrennt abgerechnet wurde. Bei allen Eggen war aber der Gemeinschaftsgedanke und die Gleichheit der Teilnehmer identisch.
Wiederbelebung des Hohnbeer
Durch das Einsetzen der Industrialisierung erlebte Heide Anfang des 19. Jahrhunderts starke Zuzüge in der Bevölkerung. Der Flecken Heide wuchs. Um gemeinschaftliche Aktivitäten zu gestalten und geschäftliche Interessen zu bündeln entwickelten sich Gilden, Kaufmannschaften und Clubs. Die plattdeutsche Sprache, bis dahin allen Bewohnern Heides gemein, verlor an Bedeutung. Es galt als unzeitgemäß und pöbelhaft, wurde die Sprache doch mit dem einfachen Volk in Verbindung gebracht.
So fühlte sich das einfache Volk ausgegrenzt. Ihnen fehlte wirtschaftliche Perspektive ebenso wie gemeinschaftlicher Halt. Auch der Wunsch der norderdithmarscher Bevölkerung, die seit 1773 zum dänischen Königreich gehörte, mit dem restlichen Schleswig-Holstein einen selbständigen Staat zu gründen, führte vielfach zur Gründung von Vereinen, die sich diesem Ziel verschrieben. Deshalb besann man sich des alten Buernreekens aus dem Mittelalter. Ein Fest, in dem wirtschaftliche Unterschiede keine Rolle spielten und Plattdeutsch das verbindende Glied war. Auf dieser Tradition wollte man wieder aufsetzen. Auch die Umzüge von Haus zu Haus wurden wieder hervorgeholt. Zu Ehren der Tradition des Boßelns auf die Tonne wurde das Fest „Hohnbeer“ (Hahnenfest) genannt. Dabei bedeutet das Wort „Beer“ nicht „Bier“ sondern „Fest“. Die Hohnbeerfarben „blau-weiß-rot“ haben auch in diesem Zusammenhang ihren Ursprung.
In der Festgarderobe des 19. Jahrhunderts machte man sich um 1829 auf, das Fest wiederzubeleben. Das genaue Gründungsdatum ist heute unbekannt. Aufgrund von Aufzeichnungen von Reden des Heimatdichters Klaus Groth als Führer ist aber bezeugt, dass es zwischen 1827 und 1829 war, als man erstmals das Hohnbeer feierte. Man verzichtete zwar auf das Einsperren eines Hahns in die Tonne, als Symbol des Festes wurde er nun auf das Fass gesetzt. Da genaue Aufzeichnungen aus der Zeit fehlen, geht man davon aus, dass alle drei Eggen zunächst gemeinsam das neue Hohnbeer feierten. 1841 war es dann die Süderegge, die vermutlich als erste Egge ihr eigenständiges Hohnbeer beging. Bei der Norderegge geht man von 1859 aus.
Die Österegge beschloss, das Wiederbeleben des Hohnbeers insgesamt als Gründungsdatum heranzuziehen. Da die Rede, in der Klaus Groth als Östereggenführer davon spricht, dass „vor 17 Jahren unser schönes Fest neu begründet wurde“, nicht genau datiert werden kann, hat man sich für das spätest mögliche Jahr entschieden. Die besagte Rede wurde definitiv in den Jahren von 1844 bis 1846 gehalten. In der Zeit, als eben die drei Vorreiter für das Heider Hohnbeer, Peter Bur, Andreas Stammer und Klaus Groth ihre wichtigste Zeit in Heide verlebten. Zurückgerechnet ergibt sich dann das Jahr 1827 bis 1829. Weder Peter Bur, noch Andreas Stammer oder auch Klaus Groth waren somit die Wiederbegründer vom Heider Hohnbeer. Aber sie waren wichtige Akteure der Neugründungszeit der heutigen drei Eggen und können somit sehr wohl als Visionäre dieser langanhaltenden Tradition angesehen werden.
Gefeiert wurde zunächst auf einem Sonntag. Auf Eingaben der Kirche wurde das Fest aber nach kurzer Zeit auf einen Montag gelegt.
1868 wurde die Verwaltungshoheit durch die preußische Gemeindereform aufgehoben und Heide als zentrale Verwaltung eingerichtet. Die Stadtrechte erfolgten dann 1870. Hohnbeer hatte lediglich dafür gesorgt, dass die Eggen, aus denen Heide einst hervorgegangen war, nicht in Vergessenheit gerieten.
Mit Blick in die Zukunft
Auch heute noch wird Hohnbeer wie nach seiner Wiederbegründung im frühen 19. Jahrhundert gefeiert. Gehalten hat sich unter anderem die Festgarderobe aus der Zeit. Deshalb zelebrieren die Eggenbrüder auch heute noch ihren Festtag im schwarzen Anzug, weißem Hemd mit weißer Fliege, weißen Handschuhen und schwarzem Zylinder. Was heute einzelnen Betrachtern gegebenenfalls sonderbar erscheinen mag, ist einzig der Tradition dieses Festes geschuldet. Da aber die Beweggründe zur Wiedereinführung des Heider Hohnbeers im 19. Jahrhundert heute noch genauso aktuell sind wie vor fast 200 Jahren, halten die Eggenbrüder bis heute an dem Ablauf des Festes und ihrer Festgarderobe fest. Damit unterstreichen sie, dass es unabhängig vom Zeitgeist ein dauerwährendes Bedürfnis der Menschen ist, gemeinsam Zeit zu verbringen, Veranstaltungen zu organisieren und unabhängig vom Alter, Beruf oder sozialem Stand das Zusammenleben in der Gemeinde zu pflegen.
Auch heute wird deshalb weiterhin an der plattdeutschen Sprache festgehalten. Jeder so gut er kann und mit dem Dialekt, der ihm gewogen ist. Die Eggenbrüder, die Plattdeutsch als Muttersprache erlernten, unterstützen diejenigen, die sie erst noch lernen oder bei der sie einfach nur ihre Basiskenntnisse verbessern und auffrischen wollen. Damit trägt Hohnbeer heute ganz massiv zur Erhaltung der plattdeutschen Sprache bei.
Die plattdeutsche Rechtschreibung
„O“ oder „a“? „Hohnbeer“ oder „Hahnbeer“? Gibt es richtige oder falsche Rechtschreibung im Plattdeutschen?
Nein, die gibt es nicht! Im Plattdeutschen schreibt jeder so, wie er es für richtig hält und wie er die Wörter selber ausspricht. Das unterscheidet sich je nach Dialekt mal mehr, mal weniger.
Klaus Groth, der große Sohn der Stadt Heide und Wegbereiter der plattdeutschen Sprache in die höhere Literatur wollte mit diesem Zustand brechen. Er strebte ein geregeltes Plattdeutsch an, wie man es heute auch aus dem Hochdeutschen kennt. Dazu musste er die verschiedenen Dialekte vereinen und ein maßgebliches Plattdeutsch definieren, welches für die Rechtschreibung ausschlaggebend war. Er bediente sich dabei verschiedener verwandter Sprachen, so dem Hochdeutschen und auch dem Dänischen. Das dänische „å“ wird als nasales „o“ gesprochen, welches in jedem Fall dem „o“ ähnlicher ist als dem „a“. Auch die Süderegge, die als einzige Egge ihr „Hahnbeer“ noch mit „a“ schreibt, spricht das Wort als „Hohnbeer“ aus. Sie führt lediglich den Versuch von Klaus Groth weiter, die Schriftsprache des Plattdeutschen zu vereinheitlichen. Auch die Norder- und Österegge schrieben bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts noch „Hahnbeer“. Da der Versuch von Klaus Groth aber letztendlich als gescheitert angesehen werden kann, gingen diese beiden Eggen dann wieder dazu über, Plattdeutsch so zu schreiben, wie es in Dithmarschen gesprochen wird. Und so wurde aus „Hahnbeer“ wieder „Hohnbeer“.
